Ich hatte nie viel über das Sterben nachgedacht. Es war etwas, das nur kurz in mein Bewusstsein drang, wenn ein mir nahestehender Mensch ging – ein vergangener Schmerz, den man irgendwann in ein hinteres Fach der Seele schiebt. Mein eigener Tod war nie ein Thema. Nie eine konkrete Vorstellung. Nie eine echte Option.
Und dann war er plötzlich da.
Ich erinnere mich an eine Zeit, die eigentlich keine Zeit sein dürfte. Ich lag in einem Hotel, so nehme ich es wahr, und draußen standen weiße Autos. Menschen wurden abgeholt, einer nach dem anderen, und es fühlte sich an, als würde jemand entscheiden, wer bleibt und wer geht. Mir war kalt. Unendlich kalt. Ich rief immer wieder: „Hilfe, ich bin Patient!“ Ein Ruf, der vielleicht mehr war als eine Bitte. Vielleicht eine Entscheidung. Vielleicht ein letzter Faden, an dem ich mich festhielt.
Drei Tage später öffnete ich die Augen auf der Intensivstation. Künstlich beatmet. Umgeben von Maschinen, deren Geräusche mehr über meinen Zustand wussten als ich selbst. Die Ärzte waren überrascht – nicht nur, dass ich wieder da war, sondern dass mein Kopf klar geblieben war. Keine Schäden, keine Lücken, nur diese Erinnerung an einen Ort, den es „eigentlich“ nicht geben dürfte.
Seitdem kämpfe ich mich zurück ins Leben. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Der Tod ist nicht länger ein fernes Konzept. Er ist ein stiller Begleiter geworden, einer, der mich daran erinnert, wie fragil jeder Moment ist – und wie wertvoll.
Ich denke heute anders über das Leben. Und über das, was danach kommt.
Ich war fort. Und doch wieder hier.
Und vielleicht besteht der Sinn dieses Weges darin, beides zu kennen – die Dunkelheit und das Licht.






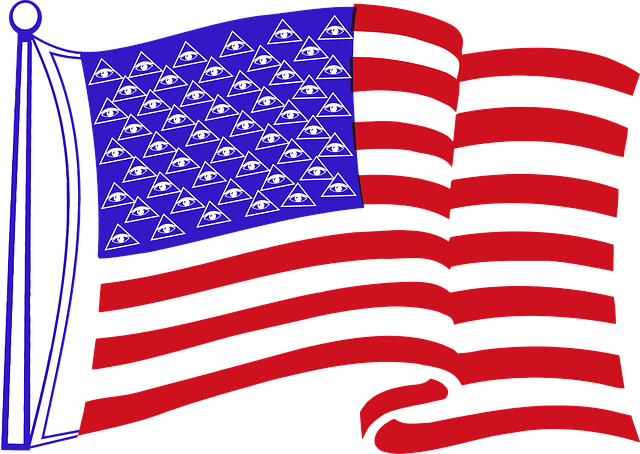




Kommentar hinterlassen