Acht Jahre nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus sieht sich Barack Obama gezwungen, seine politische Zurückhaltung aufzugeben. Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten, einst Inbegriff von Hoffnung und Zuversicht, blickt heute mit wachsender Sorge auf das politische Klima seines Landes – und auf Donald Trump. Freunde berichten, Obama sei zunehmend überzeugt, dass die amerikanische Demokratie unter Trumps zweiter Präsidentschaft ernsthaft gefährdet sei.
Obama, der sich während der Biden-Jahre weitgehend im Hintergrund hielt, plant nun eine aktivere Rolle. Laut Vertrauten arbeitet sein Team an einer neuen Strategie, die seine öffentliche Präsenz wieder stärker ins Zentrum rücken soll. Ziel sei es, der Erosion demokratischer Normen entgegenzuwirken – und der nächsten Generation von Demokraten überhaupt erst wieder Handlungsspielraum zu verschaffen. „Der Schaden ist so tiefgreifend, dass er ein anderes Maß an Engagement verlangt – auch von Präsident Obama“, sagt Eric Holder, Obamas früherer Justizminister.
Der alte Hoffnungsträger in einer neuen Dunkelheit
Obama, inzwischen 64, erkennt, dass das Amerika seiner berühmten Rede von 2004 – ohne rote und blaue Staaten, ohne Spaltung – nicht mehr existiert. Er sieht ein Land, in dem Rassismus, Misstrauen und Machtmissbrauch wieder zum politischen Alltag gehören. Besonders irritiert ihn, wie viele wohlhabende Bekannte aus seinem Umfeld sich inzwischen mit Trump arrangieren – aus purem Eigeninteresse.
Hinter den Kulissen sucht Obama den Kontakt zu Wirtschaftsführern und Institutionen, um sie davon abzuhalten, den Druck der Regierung Trump nachzugeben. Auch für den Fall weiterer juristischer Schritte gegen ihn selbst oder andere prominente Demokraten bereitet er sich vor. Selbst ob er Trump zur Eröffnung seines geplanten Präsidentenzentrums in Chicago einladen soll, wird intern diskutiert – ein symbolisches Dilemma zwischen staatsmännischer Geste und politischer Klarheit.
Die Stimme der Vernunft
Obama bleibt ein Magnet für die Demokraten. Wenn er auftaucht – etwa bei Wahlkampfterminen für moderate Kandidatinnen wie Mikie Sherrill in New Jersey oder Abigail Spanberger in Virginia – zieht er Menschenmengen an. Strategen sehen in ihm den einzigen noch glaubwürdigen Vertreter einer liberalen Mitte, die für Intellekt, Maß und Anstand steht. „In dieser Zeit brauchen die Demokraten jemanden, der die Idee der liberalen Demokratie glaubwürdig vertreten kann – und Obama ist dafür die stärkste Stimme“, sagt der Politikberater Rob Flaherty.
Doch die Zeit arbeitet gegen ihn. Für viele junge Wählerinnen und Wähler ist Obama vor allem eine nostalgische Figur – Symbol einer Ära, in der die Welt noch Sinn zu ergeben schien. „Wir müssen akzeptieren, dass er für die neue Generation nicht mehr der Coolste ist“, sagt der kalifornische Abgeordnete Isaac Bryan, selbst ein Kind der „Hope“-Ära.
Fehler, Lektionen, neue Richtung
Obamas Engagement im Wahlkampf 2024 verlief nicht reibungslos. Seine scharfen Bemerkungen über junge schwarze Männer, die sich schwer damit täten, eine Frau – gemeint war Kamala Harris – zu unterstützen, lösten Empörung aus. Obama lernte daraus und rückte bei späteren Auftritten stärker den Schutz demokratischer Institutionen in den Vordergrund.
In jüngster Zeit nutzt er seine Plattform gezielter, um auf autoritäre Tendenzen zu reagieren – ob durch subtile Spitzen gegen Trump bei Reden in London oder durch Mahnungen an junge Führungskräfte in Osteuropa. Sein Ziel: dem Lärm der Lügen eine Stimme der Vernunft entgegenzusetzen.
Mentor und Stratege
Obama bleibt zugleich Mentor einer neuen Generation. Er berät Gouverneure wie Josh Shapiro (Pennsylvania) oder Wes Moore (Maryland) und sucht das Gespräch mit progressiven Stimmen wie Faiz Shakir, einst Berater Bernie Sanders’. Auch Influencer und Medienakteure lädt er ein, um zu verstehen, wie sich politische Kommunikation verändert.
Der einstige Präsident kann nicht mehr kandidieren, aber er will Vorbild sein – als jemand, der in schwierigen Zeiten Haltung zeigt. „Wenn Überzeugungen nie geprüft werden, sind sie nur Mode“, soll Obama in vertrauter Runde gesagt haben.
So wird der Mann, der einst versprach, Amerika zu einen, nun wieder zum politischen Kämpfer – nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Pflichtgefühl. Ob er Trump aufhalten kann, bleibt offen. Sicher ist nur: Obama hat den Rückzugsmodus verlassen.







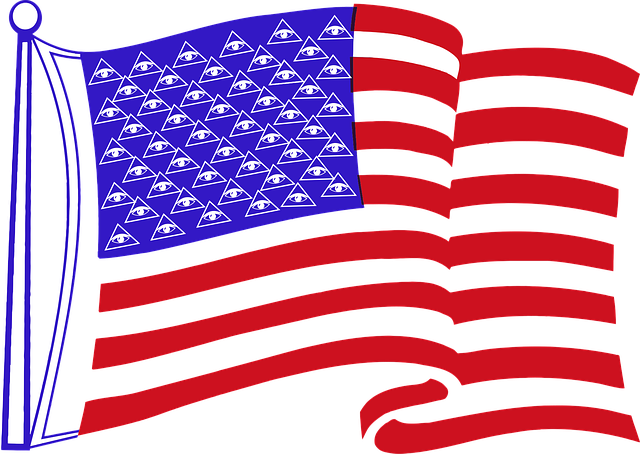



Kommentar hinterlassen