Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will den Zugang zu sogenannten „alternativen Investments“ in privaten Altersvorsorgekonten wie 401(k)-Plänen erleichtern. Was offiziell als „Demokratisierung“ von Investitionschancen verkauft wird, sorgt bei Anlegerschützern für massive Kritik. Sie warnen: Vor allem unerfahrene Kleinanleger – die sprichwörtlichen „Mom and Pop“-Investoren – könnten am Ende die Verlierer sein.
Riskante Produkte im Ruhestandsdepot
Im Zentrum der Debatte stehen alternative Anlageformen („Alts“) wie Private-Equity-Fonds, strukturierte Produkte, gehebelte ETFs, Private Placements oder Kryptowährungen. Diese Investments versprechen höhere Renditen und Diversifikation, sind jedoch oft komplex, teuer und deutlich riskanter als klassische Aktien- oder Rentenfonds.
Ein Beispiel ist Cathy Shubert aus Florida. Sie übergab einem Finanzberater mehr als 250.000 Dollar aus ihrer Altersvorsorge. Das Geld floss in strukturierte Produkte und gehebelte Fonds – Anlagen, die üblicherweise vermögenden und erfahrenen Investoren vorbehalten sind. Jahre später war mehr als die Hälfte ihres Ersparten verloren.
Solche Fälle sind kein Einzelfall. Anwälte berichten von zahlreichen Mandanten, die große Teile ihrer Altersvorsorge durch hochriskante Alternativprodukte eingebüßt haben – oft ohne die Funktionsweise wirklich zu verstehen.
Politischer Rückenwind für Deregulierung
Im August unterzeichnete Trump eine Executive Order mit dem Titel „Democratizing Access to Alternative Assets for 401(k) Investors“. Ziel sei es, mehr Wachstum und Diversifikation in Altersvorsorgekonten zu ermöglichen. Kritiker sehen darin jedoch vor allem eine Lockerung von Schutzvorschriften.
Zusätzliche Brisanz erhielt die Debatte, als Trump den wegen milliardenschweren Anlagebetrugs verurteilten GPB-Chef David Gentile begnadigte. Verbraucherschützer werteten dies als fatales Signal: Der Schutz kleiner Anleger habe offenbar keine Priorität.
Auch bei der US-Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) weht inzwischen ein deregulierungfreundlicher Wind. Ihr Vorsitzender Paul Atkins begrüßte die Öffnung alternativer Märkte für Privatanleger, betonte allerdings, es brauche „angemessene Leitplanken“.
Hohe Gebühren, geringe Transparenz
Ein Kernproblem alternativer Anlagen sind hohe Gebühren und geringe Transparenz. Studien zeigen, dass nicht börsengehandelte Immobilienfonds oder Private Placements oft deutlich schlechter abschneiden als vergleichbare börsennotierte Produkte – unter anderem wegen hoher Vertriebsprovisionen und Nebenkosten.
Hinzu kommt: Viele dieser Angebote unterliegen geringeren Offenlegungspflichten. Während börsennotierte Unternehmen umfangreiche Finanzberichte veröffentlichen müssen, gelten für private Emittenten deutlich laxere Regeln.
Gleichzeitig zeigt eine Untersuchung der Financial Industry Regulatory Authority (Finra), dass das Finanzwissen vieler US-Anleger lückenhaft ist. In einem Test beantworteten Teilnehmer im Schnitt weniger als die Hälfte der Fragen korrekt. Alarmierend: Jeder Zweite hielt ein angeblich „garantiertes“ Investment mit 25 Prozent Rendite für glaubwürdig.
Altersvorsorge als „Goldtopf“ der Branche
In den USA liegen rund 48 Billionen Dollar in Altersvorsorgekonten – ein gewaltiger Markt. Branchenkenner sprechen von einem „Goldtopf“, den Finanzfirmen erschließen wollen. Prognosen gehen davon aus, dass Privatanleger bis 2030 Billionenbeträge in private Märkte umschichten könnten.
Doch Experten warnen: Gute, lukrative Deals würden meist institutionellen Investoren angeboten. Was bei Kleinanlegern landet, sei nicht selten das, was anderswo keinen Abnehmer findet.
Hürden bei der Rechtsdurchsetzung
Wer Verluste erleidet, hat es schwer. Viele Anleger verzichten beim Kontoabschluss auf ihr Klagerecht und müssen stattdessen in nicht-öffentlichen Schiedsverfahren vor Finra vorgehen. Für kleinere Schadenssummen lohnt sich ein Verfahren oft kaum – geeignete Anwälte sind schwer zu finden.
Während große, vermögende Investoren zuletzt millionenschwere Schiedssprüche durchsetzen konnten, kämpfen kleinere Anleger häufig um jeden Dollar. Gleichzeitig lobbyieren Branchenverbände dafür, hohe Strafzahlungen in Schiedsverfahren zu begrenzen.
Warnung vor einer Wiederholung der Geschichte
Kritiker sehen Parallelen zur Zeit vor dem Börsencrash von 1929. Damals führten mangelhafte Transparenz und riskante Spekulationen zu massiven Verlusten für Privatanleger – und letztlich zur Einführung strenger Wertpapiergesetze.
Heute droht aus Sicht von Verbraucherschützern eine schleichende Aushöhlung dieser Schutzmechanismen. Für Menschen wie Kathleen McCauley, die einen Großteil ihrer 600.000 Dollar Altersersparnisse in einem privaten Fonds verlor, ist die Debatte keine abstrakte Regulierungspolitik, sondern bittere Realität. „Ich fühle mich wie in einem finanziellen Gefängnis“, sagt sie. Die entscheidende Frage bleibt: Bedeutet „Demokratisierung“ des Zugangs zu riskanten Anlagen mehr Chancen für Kleinanleger – oder vor allem mehr Risiko?



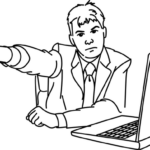







Kommentar hinterlassen