Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass auch auf einen vor Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung gestellten Antrag auf Namensänderung eines Kindes (Einbenennung) bereits die aktuellen Vorschriften angewendet werden dürfen. Maßgeblich sei der Zeitpunkt der Entscheidung, nicht der Antragstellung. Damit gelte nun der mildere Maßstab, wonach eine Einbenennung bereits dann zulässig ist, wenn sie dem Wohl des Kindes dient (§ 1617e BGB).
Hintergrund: Antrag der Mutter auf Nachnamenwechsel der Tochter
Im zugrunde liegenden Fall lebt eine fast achtjährige Tochter seit ihrer Geburt bei ihrer Mutter, die das alleinige Sorgerecht innehat. Der Kontakt zum leiblichen Vater, einem portugiesischen Staatsbürger, war von Beginn an sehr eingeschränkt. Mehrfach wurden gegen ihn gerichtliche Gewaltschutzanordnungen erlassen. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes heiratete die Mutter dessen Vater und nahm dessen Nachnamen an – denselben Namen trägt auch der gemeinsame Sohn.
Die Mutter beantragte nun, dass auch ihre Tochter aus erster Beziehung diesen neuen Familiennamen führen dürfe. Da der leibliche Vater dem nicht zustimmte, stellte sie beim Familiengericht den Antrag, seine Zustimmung gerichtlich ersetzen zu lassen.
Gericht erkennt Kindeswohl als ausschlaggebend
Das Familiengericht gab dem Antrag nach Anhörung aller Beteiligten sowie unter Einbeziehung eines psychologischen Gutachtens statt. Die dagegen eingelegte Beschwerde des Vaters wurde nun vom 2. Familiensenat des OLG Frankfurt zurückgewiesen (Az. 2 WF 115/25).
Das OLG betonte, dass die Einbenennung zulässig sei, wenn sie dem Kindeswohl diene – auch bei Anträgen, die vor dem Stichtag gestellt wurden. Der neue Maßstab sei verfassungskonform anwendbar, da es sich bei der Namensänderung um eine Regelung mit Wirkung für die Zukunft handele. Selbst wenn der Antrag unter der alten Rechtslage abgelehnt worden wäre, hätte jederzeit ein neuer Antrag unter der neuen Regelung gestellt werden können.
Ausschlaggebend: Bindung zum Vater kaum vorhanden
Aus der gerichtlichen Anhörung sowie dem Gutachten ergab sich, dass der leibliche Vater für die Tochter kaum eine Rolle spielt. Der Nachname gewinnt für die bald Achtjährige zunehmend an Bedeutung – insbesondere im sozialen Umfeld und in der Schule. Eine Namensübereinstimmung mit Mutter und Halbbruder würde ihr Zugehörigkeitsgefühl stärken.
Die Gerichte sahen deshalb das Kindeswohl durch die Einbenennung gefördert. Dem Interesse des Vaters, am bisherigen Namen festzuhalten, komme in diesem Fall kein Vorrang zu – zumal dieser Name vom Kind faktisch nie als Teil ihrer Identität empfunden worden sei.
Entscheidung nicht anfechtbar
Die Entscheidung ist abschließend und kann nicht mehr angefochten werden.
Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 28.11.2025, Az. 2 WF 115/25




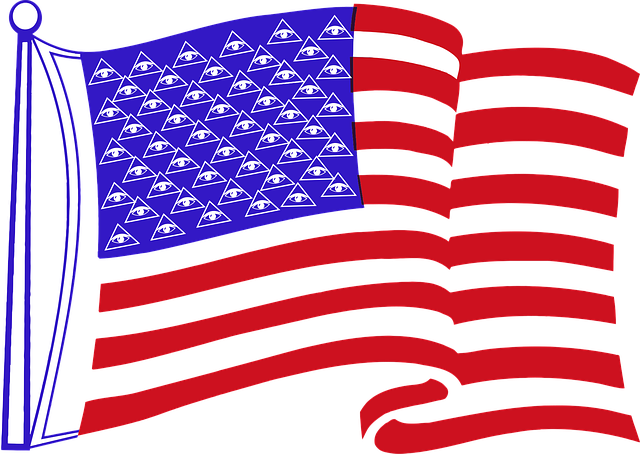





Kommentar hinterlassen