US-Präsident Donald Trump inszeniert sich derzeit zunehmend als Kriegspräsident – allerdings nicht in einem internationalen Konflikt, sondern gegen Proteste und Migranten im eigenen Land. In einer rhetorisch aufgeladenen Kampagne zeichnet er das Bild eines Amerikas im Ausnahmezustand, insbesondere mit Blick auf die Situation in Los Angeles. Der beunruhigende politische Subtext: Trump will offenbar den Einsatz von aktiven US-Truppen auf amerikanischem Boden normalisieren – und nutzt dafür gezielt ein Klima der Angst.
Der Präsident als starker Mann
Trumps jüngste Aussagen deuten auf mehr als nur politische Zuspitzung hin. Die Warnung, dass „jede Protestbewegung mit sehr großer Gewalt beantwortet“ werde, sowie seine dramatische Darstellung von Los Angeles als von „kriminellen Netzwerken“ besetzte Stadt erinnern mehr an Autokratien als an demokratische Rhetorik. Dass er die Hauptstadt Kaliforniens „befreien“ wolle, klingt wie ein Militäreinsatz im Ausland – nicht wie ein angemessenes Vorgehen in einem Bundesstaat.
In seiner Rede in Fort Bragg – einst Kulisse für George W. Bushs Irakkrieg-Appelle – beschwor Trump martialisch den Einsatz „aller verfügbaren Mittel“, um Ordnung „sofort“ wiederherzustellen. Diese Bühne nutzte er nicht nur zur Truppenbindung, sondern auch als symbolisches Signal für seine Bereitschaft, auch innerstaatlich militärisch durchzugreifen.
Alarmzeichen für die Demokratie
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sieht durch Trumps Vorgehen die Gewaltenteilung akut gefährdet. In einer Fernsehansprache warnte er vor dem „Eintreffen des Moments, den wir lange gefürchtet haben“ – dem Abbau demokratischer Grundprinzipien zugunsten präsidialer Macht. Dass Trumps Regierung offenbar überlegt, das Militär auch für Verhaftungen von Demonstranten einzusetzen – wie ein geleaktes DHS-Memo nahelegt – könnte eine Verletzung des Posse Comitatus Acts darstellen, der den Einsatz aktiver Truppen für Polizeiaufgaben verbietet.
Symbolpolitik mit System
Die aktuelle Situation ist nicht das erste Beispiel für Trumps Strategie, Krisen zur Stärkung seiner Autorität zu nutzen. Schon 2020 hatte er mit ähnlicher Rhetorik gedroht, das Militär in amerikanischen Städten einzusetzen. Heute, gestärkt durch seine Wiederwahl, scheint er entschlossener denn je, den rechtlichen Rahmen zu dehnen.
Insbesondere durch die mediale Inszenierung – Panzer in Washingtons Innenstadt, Truppenaufmärsche zum Unabhängigkeitstag und national übertragene Reden an Soldaten – wird das Bild eines „Präsidenten im Kriegszustand“ verfestigt. Kritiker befürchten, dass Trump damit gezielt auf eine erneute Anwendung des Insurrection Acts hinarbeitet, um sich über Bundesstaaten hinweg direkte Machtbefugnisse zu verschaffen.
Fazit: Drohkulisse mit Kalkül
Ob es sich um politischen Theaterdonner handelt oder um die Vorbereitung echter innenpolitischer Machtausweitung: Trumps Vorgehen erzeugt eine gefährliche Rhetorikspirale, die demokratische Institutionen und Grundrechte untergräbt. Die Präsenz von Nationalgardisten, der Versuch, Proteste zu kriminalisieren, und die Gleichsetzung oppositioneller Stimmen mit „Feinden des Landes“ sind typische Elemente autoritärer Strategien.
Was heute noch als „nur Worte“ erscheinen mag, kann morgen Realität werden – das hat die Geschichte der Trump-Ära bereits mehrfach gezeigt. Die amerikanische Demokratie steht erneut auf dem Prüfstand.



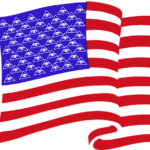



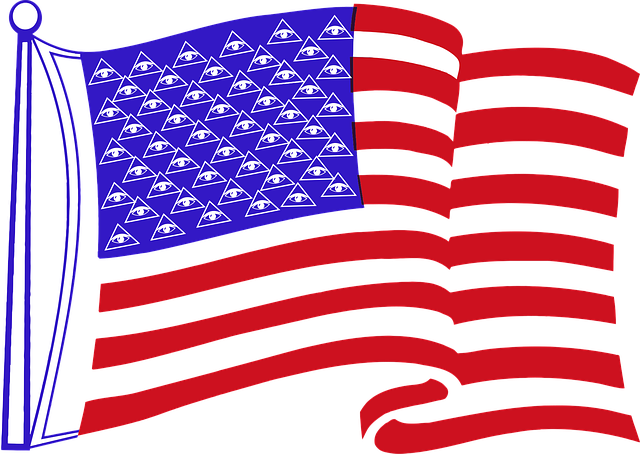



Kommentar hinterlassen