Noch vor wenigen Jahrzehnten galten die Vereinigten Staaten als verlässlicher Partner Europas – als Freund, Verbündeter, Garant westlicher Werte. Doch diese Vorstellung wirkt zunehmend überholt. Spätestens seit dem wirtschaftlichen Ringen um Ressourcen, Technologien und geopolitischen Einfluss wird klar: Die transatlantische Freundschaft ist längst zur Rivalität geworden.
Besonders deutlich zeigte sich das jüngst auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort traten Vertreter der USA mit einer Selbstsicherheit und Härte auf, die in Europa nicht nur Verwunderung, sondern auch Unmut auslöste. Die amerikanische Wirtschaftspolitik setzt klar auf nationale Interessen – „America First“ ist mehr als nur ein Slogan, es ist gelebte Strategie. Europäische Belange spielen dabei allenfalls eine Nebenrolle.
Ein Beispiel dafür ist der Inflation Reduction Act (IRA), ein riesiges US-Investitionspaket zur Förderung klimafreundlicher Technologien, das faktisch europäische Unternehmen benachteiligt. Wer in den USA produzieren will, profitiert – wer in Europa bleibt, geht leer aus. Die Reaktion aus Brüssel? Empörung, aber wenig Konsequenz. Frankreichs Präsident Macron warnte zwar vor einer Deindustrialisierung Europas, doch konkrete Gegenmaßnahmen lassen auf sich warten.
Auch in sicherheitspolitischen Fragen zeigt sich eine Verschiebung. Zwar bleibt die NATO ein zentrales Element der europäischen Sicherheitsarchitektur, doch das amerikanische Engagement ist nicht mehr selbstverständlich. Die europäische Abhängigkeit von Washington wurde durch den Krieg in der Ukraine schmerzhaft deutlich. Ohne US-Unterstützung wäre Kiew kaum in der Lage, sich gegen die russische Aggression zu behaupten. Gleichzeitig nutzt die USA ihre Rolle, um politische und wirtschaftliche Forderungen zu stellen – nicht immer zur Freude der Europäer.
Statt Zusammenarbeit scheint nun Wettbewerb die neue Normalität. Ob bei der Subventionspolitik, bei der Energieversorgung oder im Umgang mit China – Washington geht seinen eigenen Weg, oft ohne Rücksicht auf Brüssel, Berlin oder Paris. Für Europa bedeutet das: Die Zeit der politischen Naivität ist vorbei. Die USA sind nicht mehr automatisch der gute Freund an unserer Seite, sondern zunehmend ein strategischer Mitbewerber.
Wer in Davos genau hinhörte, spürte eine gewisse Arroganz in den Auftritten amerikanischer Vertreter – das selbstbewusste Auftreten einer Supermacht, die sich ihrer globalen Dominanz noch immer sicher ist. Doch Geschichte lehrt, dass überhebliche Haltungen selten dauerhaft belohnt werden. Wer Partner von oben herab behandelt, riskiert, sie zu verlieren.
Europa muss deshalb umdenken – strategischer, eigenständiger, selbstbewusster agieren. Die transatlantische Partnerschaft mag weiter bestehen, doch sie braucht neue Spielregeln. Und sie beginnt mit dem klaren Blick auf die Realität: Die Amerikaner sind keine Freunde per Definition – sondern Interessenvertreter ihrer Nation. Es liegt an uns, ebenso konsequent unsere eigenen Interessen zu vertreten. Nur so kann Europa seine politische und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit bewahren.







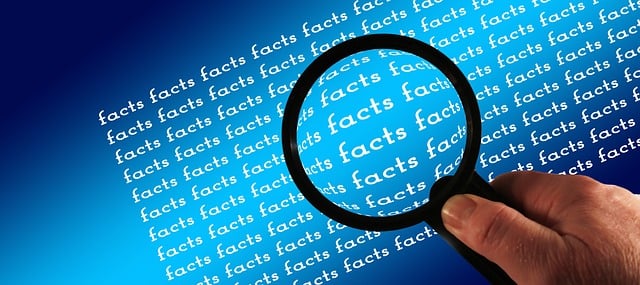



Kommentar hinterlassen